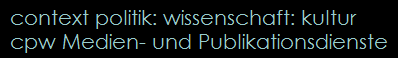Geschichte
Steinzeitliche Funde in der Nähe von Budhanikantha belegen, dass das Katmandu-Tal im Herzen Nepals schon vor 30 000 Jahren besiedelt war, als sich auf seinem Grund noch ein riesiger Gebirgssee befand, der vor 20 000 Jahren durch ein Erdbeben trocken gelegt wurde. Einen ersten schriftlichen Bezug zum heutigen Nepal lässt sich im indischen Epos Mahabharata herstellen. Dort ist von einem Land Kiratadesa die Rede, das im östlichen Himalaya gelegen haben dürfte, was möglicherweise die Herkunft der Kirata oder Kiranti klärt, die im 7. Jahrhundert v. Chr. ins Katmandu-Tal einwanderten. Dies würde auf eine tibeto-birmanische Herkunft der von den Kirata abstammenden Newar hindeuten, die in frühgeschichtlicher Zeit im Katmandu-Tal eine erste Hochkultur hervorbrachten. Dass diese aber stark indisch geprägt war, dürfte indoarischen Einwanderern zu verdanken sein, die sich mit den Einheimischen vermischten.
Malla-Dynastie
Zum ersten Mal erwähnt findet sich der Name des Himalaya-Königreiches „Nepala-Nripati“ auf einer Säule bei Allahabad im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, auf der die tributpflichtigen Vasallen des Gupta-Reiches (320-540 n. Chr.) verzeichnet sind. In diese Zeit fällt die Regentschaft der Licchavi (ab 350), einer adeligen Familie aus dem indischen Vaishali nördlich von Bihar, die sich vermutlich auf der Flucht vor muslimischen Eroberern in Nepal niedergelassen hatten, wo sie als Herrscher anerkannt wurden, obwohl sie sich im Gegensatz zu ihren überwiegend buddhistischen Untertanen zum hinduistischen Vishnuismus bekannten. Mit Amsuvarnam übernahm 620 erstmals ein einheimischer Newar die Macht. Er befreite das Land von der Fremdherrschaft und gründete das erste nepalesische Königreich, das jedoch nicht lange Bestand hatte und in zahlreiche Fürstentümer zerfiel. Um 1200 ergoss sich ein Strom von Flüchtlingen vor dem Ansturm der Muslime auf Indien in das Katmandu-Tal, darunter die Familie der Malla, die dort die Macht übernahm. Sie begründete eine Dynastie, die bis 1768 herrschte und sogar die verheerende Invasion der muslimischen Truppen des Sultans Shams ad-Din Ilyas von Bengalen 1349 überdauerte. Zu verdanken war dies in erster Linie Jaya Sthiti Malla (1382-1395), der das Reich wieder aufbaute und reorganisierte. Er setzte das hinduistische Kastensystem in Nepal durch und integrierte darin auch die buddhistischen Newar. König Jaya Sthiti gilt insofern als eigentlicher Begründer der nepalesischen Kultur und Nation.Gorkha-Dynastie
Als Umschlagplatz auf der Handelsroute von Indien nach Tibet gelangte Katmandu zu Wohlstand und Reichtum. Im Laufe der Jahrhunderte kam es durch innerdynastische Streitigkeiten zu einer zunehmenden Zersplitterung des Malla-Reiches. Die damit einhergehende Schwächung nutzten die Shah von Gorkha, um 1768 die Macht in Nepal an sich zu reißen. Sie waren Nachfahren der Fürsten von Udaipur und gehörten dem im indischen Rajasthan beheimateten Volk der Gurkha an, das von den Muslimen nach Nepal vertrieben worden war. Usurpator der Macht war Prithvi Narayan Shah, der in Nepal eine Schreckensherrschaft errichtete und eine Dynastie begründete, die trotz mancher innerfamiliärer Intrigen und Meuchelmorde bis heute besteht. Durch ihre Eroberungsfeldzüge forderten die Gorkha die britische Kolonialmacht in Indien heraus, die nepalesischen Herrscher in einem Krieg (1814-1816) in die bis heute gültigen Grenzen zu verwiesen. Zwar musste Nepal nach der Niederlage einen britischen Stützpunkt in Katmandu akzeptieren und als Verbündeter des Empires im Bedarfsfall „Gurkha-Söldner“ zur Verfügung stellen, entging aber auf diese Weise einer direkten Kolonisierung.
Unterbrochen wurde die Herrschaft der Shah durch einen Militärputsch des Generals Jung Bahadur Kunwar am 15. September 1846. Dieser nahm zwar den altindischen Herrschernamen Rana an, machte dem nepalesischen König seine Würde als Inkarnation des göttlichen Vishnu aber nicht streitig. Statt dessen degradierte er ihn zur rein repräsentativen Marionette und regierte selbst als Premierminister. 1856 nahm Jung Bahadur Rana den Titel eines Maharadschas an, wodurch das Amt als Premierminister innerhalb der Rana-Familie erblich wurde. Er knüpfte durch Einheiratung seiner Kinder zwar verwandtschaftliche Bande mit der Königsfamilie und pflegte einen fürstlichen Lebensstil. Er leitete jedoch auch eine tiefgreifende laizistische Reformpolitik ein, sorgte für den Einzug von Technik und Bildung in Nepal und unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu Großbritannien.
Sturz des Rana-Regimes
Der erlahmende Reformeifer seiner Nachfolger, die Nepal immer mehr als Privatbesitz betrachteten und zulasten des einfachen Volkes einem gesellschaftlichen Elitarismus huldigten, führte zu wachsender Unzufriedenheit. Unter dem Eindruck von Mahatma Gandhis erfolgreichem Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft machten sich in Nepal Befreiungsideen und aufklärerisches Gedankengut breit, die das Volk politisierten und sich 1947 in der Bildung oppositioneller Gruppierungen wie dem Nepali National Congress manifestierten. Dieser vereinigte sich 1950 mit dem Nepali Democratic Congress und rief unterstützt von der indischen Regierung und vom nepalesischen König Tribhuvan Bir Bikram Shah erfolgreich zum Sturz des Rana-Regimes auf. Im Frühjahr 1951 wurde in Nepal eine konstitutionelle Monarchie nach britischem Vorbild eingeführt und 1959 in einer Verfassung ausgestaltet. Im selben Jahr fanden die ersten landesweiten Wahlen statt, aus denen der Nepali National Congress als Sieger hervorging. Premierminister wurde Bishweshwar Prasad Koirala, der bereits an der Seite von Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru für die indische Unabhängigkeit gekämpft hatte.
Panchayat-System
Doch bereits 1960 machte König Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972) der Demokratie gewaltsam ein Ende und ließ die führenden Politiker ins Gefängnis werfen. 1961 führte der König das so genannte Panchayat-System (indische Bezeichnung für gewählte dörfliche Selbstverwaltungsgremien) ein, das eine politische Teilhabe des Volkes nur auf lokaler Ebene zuließ, und sicherte sich durch eine neue Verfassung 1962 die absolute Macht im Staat. Trotz einer politischen Liberalisierung unter der Regentschaft von Birendra Bir Bikram Shah (1972-2001), hatte das Panchayat-System bis 1990 Bestand. Zu Fall gebracht wurde es durch eine Reihe blutiger Volksaufstände, die die verbotene Nepali Congress Party (NCP) – vormals Nepali National Congress – aus dem Untergrund tatkräftig mitinitiierte. Im November 1990 verkündete König Birendra eine neue Verfassung, durch die Nepal nach dreißigjähriger autokratischer Herrschaft zur konstitutionellen Monarchie zurückkehrte. Bei den ersten freien Wahlen seit 32 Jahren setzte sich die NCP durch.
Maoistischer Volkskrieg
Doch mangels Demokratiefähigkeit krankte Nepal schon bald an Vetternwirtschaft, Korruption und Diskriminierung. Die Schere zwischen einer kleinen reichen Oberschicht und der Masse der Armen öffnete sich immer weiter. Dies gab kommunistisch-maoistischen Gruppierungen Auftrieb, die sich zur Communist Party of Nepal-Unity Centre (CPN-UC) zusammenschlossen. Das Bündnis wurde bei den Wahlen 1991 drittstärkste politische Kraft, löste sich aber nach zweijährigen Bestehen wieder auf. Der Führer des ultraradikalen Flügels Pushpa Kamal Dahal, besser bekannt unter dem Namen Prachanda, formierte 1993 die Communist Party of Nepal-Maoist (CPN‑M), die sich die Errichtung einer kommunistischen Volksrepublik nach chinesischem Vorbild auf die Fahnen schrieb. Im Februar 1996 forderte Prachanda in einem 40-Punkte-Papier die Regierung ultimativ auf, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, Diskriminierungen aufgrund von Kastenzugehörigkeit oder Geschlecht abzustellen und die Monarchie durch ein säkulares Staatswesen zu ersetzen.
Noch vor Ablauf der zweiwöchigen Bedenkfrist verliehen militante Anhänger der Maoistenpartei ihren Forderungen mit Anschlägen, Entführungen und Sabotageakten Nachdruck. Sodann riefen diese so genannten Maobadi, die viel Sympathien in der landlosen Bauernschaft genossen, zum bewaffneten „Volkskrieg“ gegen die Regierung auf, die den Ernst der Lage bis 1999 völlig unterschätzte. Als Vorbild ihres Guerillakrieges, in dessen Verlauf sie weite Teile Landes unter Kontrolle brachten, diente den Rebellen die Strategie von Maos Bauernrevolution einschließlich Terror, Exekutionen, Schutzgelderpressungen, Vertreibungen sowie die Liquidation von Großgrundbesitzern und anderen „konterrevolutionären Elementen“.
Am 1. Juni 2001 fielen König Birendra und neun Mitglieder seiner Familie einem Amoklauf des vermutlich unter Drogen stehenden Kronprinzen Dipendra zum Opfer, der wenige Tage nach dem Blutbad seinen eigenen Verletzungen erlag. Die Ermordung des populären Königs und die Inthronisation seines unbeliebten Bruders Gyanendra Bir Bikram Shah lösten schwere Unruhen aus. Korruptionsvorwürfe, Kritik an seiner Unfähigkeit, den maoistischen Terror zu beenden und das schlechte Krisenmanagement nach dem Massaker im Königshaus brachten am 19. Juli den amtierenden Ministerpräsidenten Girija Prasad Koirala zu Fall.
Machtergreifung des Königs
Nachfolger wurde Sher Bahadur Deuba, der eine deutlich härtere Gangart gegen die Maobadi ankündigte. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Bürgerkriegs – die „Revolutionäre Volksregierung“ der Rebellen kontrollierte inzwischen weit über die Hälfte des Landes – enthob König Gyanendra im Oktober 2002 Deuba wegen Unfähigkeit seines Amtes und übernahm vorübergehend selbst die Macht. Nach mehreren ebenso erfolglosen kurzlebigen Regierungen rief Gyanendra 2005 den Ausnahmezustand aus, löste das Parlament auf und setzte die Verfassung und Bürgerrechte teilweise außer Kraft. Er scharte ein Kabinett aus Königstreuen um sich und schwang sich trotz lautstarker internationaler Proteste selbst zum Staats- und Regierungschef auf. Im März 2005 folgten die USA und Großbritannien dem Vorbild Indiens und setzten die finanzielle und militärische Hilfe für Nepal aus – wobei Indien seine Waffenlieferungen wieder aufnahm, als China und Pakistan in die Bresche sprangen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Maobadi mit den in der Assam-Region aktiven indischen Untergrundbewegungen People's War Group (PWG) und Maoist Coordination Center (MCC) kooperieren.
Sturz der Diktatur und Friedensprozess
Um mit den sieben wichtigsten Oppositionsparteien ins Gespräch zu kommen, die sich nach Gyanendras Machtergreifung zu einer Allianz zusammengeschlossen hatten, verkündeten die Rebellen im September 2005 eine einseitige Waffenruhe. Beide Seiten schlossen ein Bündnis und organisierten Massenproteste. Nach vergeblichen Bemühungen, den Widerstand durch Massenverhaftungen und Repression zu brechen, gab der König dem Druck von der Straße nach. Die siegreiche Parteienallianz kürte Girija Prasad Koirala zum Ministerpräsidenten. Um eine zentrale Forderung der Volksbewegung einzulösen, stellte die Regierung eine neue Verfassung in Aussicht, die die Macht des Königs beschränken soll. Ferner erwiderte sie offiziell die Waffenruhe und nahm mit den Maobadi Verhandlungen auf, die am 21. November 2006 in ein Friedensabkommen mündete, das den seit zehn Jahren andauernden Bürgerkrieg beendete, der mittlerweile mehr als 13 000 Todesopfer gefordert hatte. Das Abkommen sieht u. a. die Entwaffnung der Rebellen sowie die Einsetzung eines Übergangsparlaments zur Wahl einer verfassunggebenden Versammlung vor.
Verfasst von:
Roland Detsch