|
Manifest der Vernunft Klimawandel fordert Paradigmenwechsel in Architektur und Planung Von Roland Detsch
Stickige Luft, überflutete Straßen, abgedeckte Dächer – vor allem der dicht bebaute urbane Siedlungsraum erweist sich immer wieder besonders anfällig gegen außergewöhnliche Witterungsereignisse. Derweil sind sich die Klimaforscher einig: Was heute noch als Wetterextrem empfunden wird, wird bald Normalität sein. Prognosen deuten darauf hin, dass sich Raumplaner und Städtebauer in Ostdeutschland, dem norddeutschen Tiefland sowie im Becken und der Hügellandschaft Südostdeutschlands künftig auf mehr Trockenheit einstellen müssen, während sie es in den Regionen der rechts- und linksrheinischen Mittelgebirge mit höheren Niederschlägen zu tun bekommen werden. Die Menschen im Oberrheingraben werden häufiger unter Hitzwellen stöhnen und von Hochwasserkatastrophen heimgesucht. Was aufgrund des steigenden Meeresspiegels auch für die Küstenbewohner gilt, denen obendrein immer öfter orkanartige Stürme ins Haus stehen. Gletscherschmelze und auftauender Permafrost in den Gipfelregionen der Alpen werden dort wiederum mehr Lawinen, Steinschläge, Muren und Überschwemmungen auslösen. Unabsehbare Folgen Welche Anforderungen Extremwetterlagen auf urbane Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Abwasserkanäle, Brücken oder Deiche stellen, liegt einigermaßen auf der Hand. Was dagegen feuchtere Winter und heißere Sommer langfristig für Bauten bedeuten, lässt sich offenbar weniger abschätzen. Forderungen, die Normen für Bauplanung, -technik und -ausführung an den Klimawandel anzupassen, sind leichter gesagt als getan. Zumal sie sich bisher für gewöhnlich an Beobachtungsdaten aus der Vergangenheit orientiert haben, Gebäude und Infrastruktureinrichtungen aber auf teils Hunderte Jahre angelegt sind. Um Engagement zu zeigen, hat sich die Politik unterdessen auf Forschung und Förderung verlegt. Mit dem Programm klimazwei unterstützt das Bundesforschungsministerium Projekte zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Entwicklung von Maßnahmen und Handlungshilfen zur Anpassung an den Klimawandel. Das 75 Millionen Euro schwere Förderprogramm Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten (KLIMZUG) soll Kommunen und Planungsbehörden bis 2013 fit für die zu erwartenden Extremwetterlagen machen. Dabei zielt das Regionale Klimaanpassungsprogramm für die Modellregion Dresden (REGKLAM) auf die Erarbeitung von Strategien zu Klimaanpassung städtebaulicher Strukturen ab. Gebäude als Klimakiller Dabei gehören zu den größten Klimakillern neben Verkehr und Industrie die Gebäude selbst. So gehen allein in Deutschland schätzungsweise 20 Prozent des gesamten Energiebedarfs auf ihr Konto. Um das Ziel des UN-Klimarats, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um bis zu 80 Prozent zu senken, auch nur annähernd erreichen zu können, wird von Experten ein baukultureller Paradigmenwechsel für unumgänglich gehalten. Vorbei sind die Zeiten in denen es sich die Baukünstler erlauben konnten, allein der Ästhetik zu frönen. Obwohl Deutschland in puncto Umwelttechnologie führend ist, gehören umweltgerechtes Bauen und energieeffziente Haustechnologie nicht gerade zu den Königsdisziplinen in der Architekturausbildung. Während der Markt unter einer Architektenschwemme ächzt, fristet die Öko-Architektur noch immer ein Nischendasein und bleiben zukunftsträchtige Marktlücken ungenutzt. So ist etwa das nationale Großprojekt zur Modernisierung und Sanierung von Altbauten hauptsächlich die Sache von Technikern, Handwerkern und Produzenten geblieben und hat bislang weitgehend ohne die Beteiligung von Architekten stattgefunden. Doch es gibt auch Ausnahmen. Allen voran der Stuttgarter Stararchitekt Werner Sobek, der mit seinen futuristischen Bauten den eindrucksvollen Beweis antritt, dass Ökogebäude nicht aus Lehm bestehen müssen. Aufsehen erregende Akzente weiß auch immer wieder der Münchner Architekt Thomas Herzog zu setzen, der in den Achtzigerjahren zu den Solarhaus-Pionieren gehörte. Ein weiterer Avantgardisten des nachhaltigen Bauens ist der selbst ernannte „SolarArchitekt“ Rolf Disch aus Freiburg. Seine Baukunst steht für die Verbindung von Funktion, Ökologie und Ästhetik. Deklaration unterzeichnet Dischs Spezialität sind Plusenergiebauten, die im Unterschied zu konventionellen und selbst zu Niedrigenergie- und Passivhäusern eine positive Energiebilanz vorweisen können. Das heißt, dass sie mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Hausdach und Fassade dienen als eine Art Solarkraftwerk, das sauberen Strom produziert, dessen Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist wird. Im Baukastensystem angeboten, erlauben Plusenegiehäuser ein Höchstmaß an gestalterischer Freiheit. Einen Glanzpunkt setzte Disch mit seinem Heliotrop in Modulbauweise. Das im Gleichschritt mit der Sonne drehbare Wohn- und Geschäftshaus, dessen Prototyp seit 15 Jahren in Freiburg steht, scheint einem Science Fiction entsprungen. Zu den führenden Exponenten nachhaltiger Baukunst gehört auch der weltweit operierende Architekt Stefan Behnisch aus Stuttgart. Zu den Vorzeigeprojekten der Behnisch Architekten gehört der im Bau befindliche Marco-Polo-Tower in der Hamburger Hafen-City, eine 16geschossige Gebäudeskulptur, die 58 Luxuswohnungen beherbergen soll. Das „ungewöhnlichste Wohnhaus“ der Hansestadt basiert auf einem ausgetüftelten Konzept für ein ökologisches Niedrigenergie-Hochhaus. Stefan Behnisch gehört auch zu den Erstunterzeichnern der Deklaration Vernunft für die Welt, die am 27. März 2009 Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee überreicht wurde. „Mit diesem Manifest bekennen wir uns als Architekten, Ingenieure und Stadtplaner ausdrücklich zur besonderen Verantwortung unserer Profession: Mit nachhaltiger Architektur und Ingenieurbaukunst können und wollen wir einen entscheidenden Baustein zum notwendigen Wandel in der Nutzung unserer natürlichen Ressourcen liefern“, heißt es in der Präambel. Links: Regionales Klimaanpassungsprogramm (REGKLAM) Manifest der „Vernunft für die Welt“ Werner Sobek Engeneering & Design Architekturbüro Rolf Disch Herzog + Partner Behnisch Architekten Dieser Artikel oder eine Version erschien erstmalig auf der Website des Goethe-Instituts e.V. unter www.goethe.de...>>weiter |
| Mai 2009 (© cpw Medien- und Publikationsdienste) |
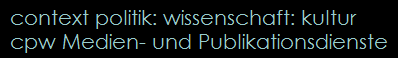
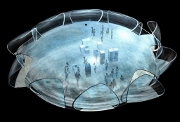 Ob
Sonnenhitze, Starkregen oder Stürme – es sind vor allem Bauwerke,
die das Wetter auf die Probe stellt, wenn es einmal wieder Kapriolen
schlägt. Die Auswirkungen des Klimawandels gehören insofern
sicherlich zu den größten Herausforderungen des Bauwesens. Aber vor
allem den Architekten in Deutschland fällt das Umdenken noch immer
nicht leicht.
Ob
Sonnenhitze, Starkregen oder Stürme – es sind vor allem Bauwerke,
die das Wetter auf die Probe stellt, wenn es einmal wieder Kapriolen
schlägt. Die Auswirkungen des Klimawandels gehören insofern
sicherlich zu den größten Herausforderungen des Bauwesens. Aber vor
allem den Architekten in Deutschland fällt das Umdenken noch immer
nicht leicht.